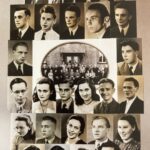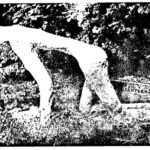Seit 1949 gibt es das Abitur an der Dreieichschule. Da 1950 und 2022 keine Abiturprüfungen stattfanden, sind es nunmehr 75 Abiturjahrgänge, die an unserer Schule den höchsten Bildungsabschluss erzielt haben. Dies ist auch ein kleines Jubiläum und soll an dieser Stelle eine kurze Würdigung erfahren.
Stellvertretend werden einige Jahrgänge näher betrachtet, in der beigefügten Tabelle ist eine Statistik der kompletten Abiturhistorie wiedergegeben.
Noch eine Vorbemerkung: Schon lange vor dem zweiten Weltkrieg war es üblich, dass am Ende der Schulzeit, als Gefühl des Abschlusses und der Befreiung, das nun unnütz gewordene Schulmaterial und Schulbücher verbrannt, ins Wasser geworfen oder verschenkt wurde. Aus diesem Akt der Loslösung von der Schule entwickelte sich in mehreren Stufen
1949
Nach dem Krieg konnte 1949 die erste Reifeprüfung (so hieß damals die Abiturprüfung) an unserer Schule (damals hieß sie noch Realgymnasium) durchgeführt werden. Alle Fächer mussten bis zum Ende belegt werden, eine Wahlmöglichkeit oder Leistungsdifferenzierung gab es nicht. 26 Prüflinge (darunter 6 Frauen) wurden am 30.6.1949 zur Reifeprüfung zugelassen. Neben den Leistungen in den einzelnen Fächern waren auch ein Gutachten, dass vom Klassenlehrer verfasst und die Reife bescheinigt, und ein handgeschriebener Lebenslauf mit Bildungsgang Grundlage für die Zulassung. 49 fanden die schriftlichen Prüfungen als Zentralabitur in der Zeit vom 22. – 25.08.1949 in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Latein statt. Die mündlichen Prüfungen fanden am 20. und 21.9.49 statt. Die Abiturienten wussten nicht (!), in welchen Fächern sie geprüft wurden, nach Maßgabe der damaligen Prüfungsordnung wurden sie aber in der Regel an einem (!) Prüfungstag in drei Fächern geprüft. Die Reifezeugnisse wurden in einer Feierstunde am Samstag, den 24.9.49, ausgegeben. Die Zeugnisse enthielten 5 Notenstufen (sehr gut, gut, genügend, mangelhaft, ungenügend) und es wurde ein Gesamturteil attestiert (mit Auszeichnung bestanden, gut bestanden, bestanden). Zudem ist das der angestrebte Beruf genannt.
Die 50er Jahre
Deutschland befand sich im Wiederaufbau und die schlimmsten Hungerjahre waren vorüber. Nur wenige Schüler und Schülerinnen legten die Reifeprüfung, so waren es 1951 bei einer Gesamtschülerzahl von 608 nur 11 Prüflinge, 1959 immerhin schon 33 bei 645 Lernenden. Mehrere Änderungen in der Reifeprüfungsordnung traten in Kraft: 1951 wurden die schriftlichen Prüfungsaufgaben nicht mehr durch das Kultusministerium gestellt und 1953 wurde ein Sportabitur eingeführt, da man der Meinung war, dass „die Schule die Aufgabe hat, für eine gleichmäßige Entwicklung der körperlichen, geistigen und charakterlichen Anlagen des Jungen Menschen zu sorgen. Der Leibeserziehung kommt bei der Erfüllung dieser Aufgabe eine wesentliche Bedeutung zu, da sie nicht nur für die körperliche Entwicklung, sondern auch für die Charakterbildung wichtig ist.“ (Erlass vom 2.3.1953) Nur mit amtsärztlichen Gutachten konnte man befreit werden, die damaligen Prüfungsakten sind voll davon. Die Bildungspläne aus dem Jahr 1956 führten an der Dreieichschule zu einer ersten Differenzierung in den neusprachlichen und den mathematisch-naturwissenschaftlichen-Zweig. 1959 wurde mit dem Stufenabitur eine Änderung eingeführt, bei der im neusprachlichen Zweig die schriftliche Reifeprüfung in Mathematik, im math.-naturw. Zweig die Fremdsprache in die 12. Klasse vorgezogen wurde. Dieses Experiment wurde aber bereits nach drei Jahren wieder revidiert. Das Zeugnis der Reife enthielt keine Aussage mehr über den Berufswunsch und auch das Prädikat entfiel. Die Notenstufen gingen von 1 bis 6. Für die Oberstufe gab es in den 50ern schon Abschlussfahrten, die mehr oder weniger nur Ziele im damaligen Westdeutschland hatten.
Die 60er Jahre – Zeit des Aufschwungs
Die Zweiteilung in sprachlichen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig aus den 50er Jahren erwies sich als Erfolgsrezept. Ebenso blieb das Sportabitur eine konstante Größe. Auch waren Deutsch und Mathematik Pflichtfächer im schriftlichen Abitur.
Die Differenzierungsmöglichkeiten stiegen. 1964 konnten etliche Fächer nach der 12. Klasse abgewählt werden, wie z. B. eine Fremdsprache oder eine Naturwissenschaft, schon nach der 11. Klasse hatte man nur noch ein musisches Fach. Die mündlichen Prüfungen wurden aus einer deutlich kleineren Zahl an Fächern vom Prüfungsausschuss bestimmt (vier schriftlichen Prüfungsfächer, Gemeinschaftskunde und ein Wahlprüfungsfach) und es waren meist nur noch ein oder zwei Prüfungen. Im Zeugnis sind Gesamtnoten abgedruckt, in denen die Jahres- und Prüfungsleisten zusammengefasst wurden.
Ein kurzer Bericht aus dem Jahr 1963 soll schildern, wie damals die Abiturienten das Abitur durchlebt haben. Die Studienfahrt ging bereits ins Ausland, so standen Wien, Rom und Holland auf dem Programm. Bis 1966 war vor Ostern das Ende des Schuljahres, das schriftliche Abitur mit vier Klausuren lief im Januar in einer (!) Woche ab, das mündliche Abitur wurde 1963 während der närrischen Zeit abgehalten. Dies führte zu Unmut! Am Aschermittwoch (27.2.1963) war dann das diesjährige Abitur zu Ende. In einem Klassenzug mit einem Pritschenwagen ging es durch die Stadt, Sektflaschen wurden gestemmt und in der Schule wurden die alten Schulhefte verbrannt. Ein Schulbaumodell wurde mit Benzin übergossen und verbrannt, die beliebtesten Lehrkräfte erhielten Hochrufe und vier Luftballons geschmückt mit den Namen von Klassenlehrern und Schulleitung gingen in die Luft. Am 3.3. gab es einen Abiturientenball, die Entlassungsfeier fand am 6.3. (Mittwoch) im evangelischen Gemeindehaus statt, abends traf man sich nochmals in einer kleinen Abschiedsfeier in kleiner Runde. Zudem gab es noch am 10.3. eine große Abiturfeier in der Westendhalle.
Ende der 60er kündigte sich ein Umdenken an. Die Feierstunde 1968 hatte den äußeren, prätentiösen Rahmen der vorigen Veranstaltungen, es gab aber in der Rede des Abiturienten Jürgen Schimmel viele kritische Töne zum Schulsystem, insbesondere rund um das Fach Sport. Dies ist ein kleiner Affront, wurde doch in vorherigen Feiern nur auf Gelungenes und Schönes in der Schulzeit zurückgeblickt. Der Individualismus brach sich Bahn, weg von Konventionen und Konformismus. 1969 hatte sich für eine Feierstunde nur eine der 4 Abiturklassen entschieden, so gab es nur im Zeichensaal eine kurze Ansprache des Schulleiters und die Ausgabe der Zeugnisse.
Die 70er Jahre – politisch aufgeladen, zerrissen und der Bruch mit der Tradition
1970 hieß es nicht mehr „Zeugnis der Reife“ sondern „Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife“. Auch Bildungsgang des Prüflings sowie das Lehrergutachten entfielen. 1978 entfiel auch die Erstellung eines Lebenslaufes. Großer Diskussionsstoff war die nach Staatsvertrag vereinbarte „Durchschnittsnote“, die 1973 zum ersten Mal im Zeugnis erschien und oftmals mit Notenterror und Chancenungerechtigkeit in Verbindung gebracht wurde. Bei den mündlichen Prüfungen konnten die Prüflinge nach einem Beratungstag der Schule durch Willenserklärung zumindest Zahl und Fach der Prüfungen mitbestimmen. Der große Wechsel kam 1976, als die Oberstufenreform eintrat. Grundlegende Veränderungen waren: Kursverband statt Klassenverband, das Notenspektrum wurde von den alten Leistungsstufen 1 bis 6 auf ein Punktesystem von 0 bis 15 Punkten umgestellt und es wurden zwei Niveaustufen als Grund- und Leistungskurse ins Leben gerufen. Das Sportabitur für alle entfiel und viele Fächer konnten in der letzten Jahrgangsstufe abgewählt werden, darunter auch Deutsch und Mathematik. Der Prüfling wählt nach den gesetzlichen Vorgaben sein mündliches Prüfungsfach aus. Nach einem komplizierten Schlüssel wurden die Halbjahresnoten der Grund- und Leistungskurse sowie der Abiturprüfungen zusammengetragen und zu einer Durchschnittsnote verrechnet. Auch die Jahrgangsstufe 11 war im Kurssystem eingerichtet, im zweiten Halbjahr wurden Leistungsvorkurse (fünfstündig) installiert. 1979 fand zum ersten Mal das Abitur nach diesen Bedingungen an der Dreieichschule statt.
Groß gefeiert wurde nicht mehr, hier eine Synopse der Ereignisse rund ums Abitur in den 70er Jahren:
1970 – keine „stereotype“ Entlassungsfeier, SL Schlüsselburg hält eine Rede, Übergabe von Buchpreisen und gemütliches Beisammensein in den Zeichenräumen der Schule;
1971 – die meisten Abiturienten wollten auf eine Zeugnisausgabe verzichten, Schulleiter Schlüsselburg äußerte sich enttäuscht über so viel Abwertung des Abiturs, es wird eine Zeugnisübergabe im Musikpavillon am Samstag um 11.30 Uhr durchgeführt.
1972 – keine großen Reden, alles in zeitgemäßer Sachlichkeit, eine kurze musikalische Darbietung (Haydn und Gospelsong) gratuliert Schulleiter Koch kurz und überreicht die Zeugnisse, danach eine kleine Stehparty mit Erfrischungsgetränken
1973 – wieder Musikpavillon am Samstagvormittag mit Klavier-Konzert von Mozart, Koch mit Glückwünschen an die Abiturienten, Hagelgans mit Spirituals und Beatgruppe „Niemandsland“, Imbiss im Nebenraum. Parolen auf dem Schulhof: „Zerschlagt die Diktatur des Bürgertums“ und „Koch – Sicherheit durch Recht und Ordnung [über den Namen Koch ist noch eine Pickelhaube gezeichnet]“, ungezwungene Kleiderordnung in Minis, Bluejeans oder auch Blazer oder Anzug
1974 – Freitag im Musikpavillon, kurze Ansprache des Direktor Koch, Chor und Orchester von Hagelgans, „Niemandsland“ Band.
1975 – geschmackloser Scherz: Am Haupteingang stand ein Galgen mit einer Puppe dran und beschriftet mit „Leerkörper“, eine andere Gruppe von Abiturienten pflanzte nach der Abschlussfeier am Freitag einen „Baum der Hoffnung“. Kurze Ansprache von Koch und musikalische Darbietungen, Koch bekommt ein echtes Ferkel „Glücksschwein“ geschenkt, eine Schülerin vermerkt dazu: „Dies ist nicht als Beleidigung gedacht, sondern als Vertrauensbeweis. Gewagte Geschenke für humorvolle Menschen.“ Wand- und Fenstermalereien verursachten eine saftige Reinigungsabrechnung – bis zum Ende des Jahrzehnts gibt es keine Wand an der Schule, die keine Schmierereien trägt.
1976 – Auf eine Feier wurde verzichtet (Zeugnis wurden postalisch zugestellt oder waren im Direktorat abzuholen), stattdessen wurde als bleibende Erinnerung an ihre Schulzeit eine Bank für den Schulhof aufgestellt. Aufgedruckt „Otium cum Dignitate“ (Muße mit Würde) und gestiftet von der Klasse 13 Sa, dazu kamen noch Privatinitiativen: Der Schulhof wurde mit „Spinnengewebe“ versehen und als „NC [Numerus Clausus] Parcours“ tituliert als Anspielung auf den bevorstehenden Weg ins Studium, andere hatten einen Spielplatz eingerichtet, um Lehrer und sich selbst auf die Schippe zu nehmen. Viele hätten gerne eine Feier gehabt.
1977 – nur eine kurze Zeitungsnotiz, wer bestanden hat – von irgendwelchen Aktionen ist nichts bekannt.
1978 – Abi-Gag mit Denkmal eines geplagten Schülers und Gipsfigur des von der Schullast niedergedrückten „Abiturient 78“ zeugen von origineller Kreativität, Stehfeier auf dem Schulhof. Aber der Unterricht sollte auch ausfallen: Nachts wurden Eingänge barrikadiert, Schlösser mit Silikon gefüllt und pornografische Bilder aufgehängt.
1979 – Eine Mauer aus Bierflaschen und ein riesiges gemaltes Hanfblatt versperrten beim Abigag den Schuleingang. Ein Pavillon wurde rosa bemalt und überall fanden sich Marihuana-Embleme.
Die 80er Jahre – Umweltschutz, AIDS und Friedensbewegung
Von 1979 bis 1982 konnten Prüflinge ein vorgezogenes Abitur machen. Bereits im Schuljahr 1983/84 wurde das Kurssystem in der 11 wieder abgeschafft und man kehrte zum Klassenverband zurück. Ab dem Abitur 1985 wurden die Beleg- und Einbringverpflichtungen wieder verschärft, so mussten Deutsch und Mathematik bzw. eine Fremdsprache über alle vier Halbjahre belegt und eingebracht werden. Bei den Abiturtraditionen gab es zwei Neuerungen: 1982 erschien das erste Abi-Buch, es wurde von Sabine Fries nach dem Modell des amerikanischen „Yearbook“ ins Leben gerufen und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Nun fanden auch wieder regelmäßig Entlassungsfeiern statt und 1988 gab es seit 20 Jahren wieder einen Abi-Ball, der in der Stadthalle war. Die Abigags waren fest etabliert: Wandparolen „verschönerten“ das Schulgebäude, politisch motivierte Themen traten mehr und mehr in den Hintergrund, individueller Spaß und auch persönliche Abrechnung mit manchen Lehrkräften wurden bestimmend.
Als Beispiel sei das Abitur 1983 beschrieben: Obwohl in den 80er Jahren wieder regelmäßige Abiturfeiern stattfanden, erfüllte sich dieser Wunsch für den Abiturjahrgang 1983 nicht. Grund für die kurzfristige Absage der Feier: Einige wenige hatten trotz vorheriger, eindringlicher Mahnung der Schulleitung auf der Rückwand der Fahrradhalle „Pinguin-Sprüche“ aufgesprüht. Da in den letzten Jahren immer wieder Wandschmierereien auftraten, deren Entfernung viel Geld kostete, wollte der Schulleiter Koch jetzt ein Zeichen setzen. Eltern und Schüler versuchten noch eine Rücknahme der Abiturfeierabsage bei der Schulleitung zu erwirken, jedoch ohne Erfolg. Dennoch fand eine Feier von den Prüflingen initiiert auf dem Schulhof statt, immerhin durfte man die Stühle aus der Schule verwenden. Ein Abiturient verlieh in Hobby-Koch-Outfit die Zeugnisse, Gags und Wetter waren beides gelungen.
Die 90er Jahre – Wiedervereinigung und Zerfall der Sowjetunion, klassische Handys und Internet
Die Kriegsgefahr schien nach dem Zerfall der Sowjetunion gebannt, Computer traten in den Blickpunkt, emails und World Wide Web wurden zu immer wichtigeren Kommunikationsmedien.
1993 wurde der Abiball mit der Übergabe der Abiturzeugnisse verknüpft, sodass die Entlassungsfeier entfiel. Die Abigags nahmen an Intensität und Ausmaß zu, Belangloses aber auch abfällige Statements wurden auf nahezu sämtlichen Wandflächen der Schule sichtbar, Alkohol- und Drogenkonsum waren ein Problem.
Die 2000er Jahre – Smartphones und digitale Welt, Selbstinszenierung und Globalisierung
Am Anfang des neuen Jahrtausends gab es wichtige Änderungen, die das Abitur bis heute mitbestimmen: 2005 wurden Deutsch und Mathematik zu verpflichtenden Abiturprüfungsfächern, zudem kam eine fünfte Abiturprüfung hinzu, die als weitere mündliche Prüfung, Präsentationsprüfung oder Besondere Lernleistung durchgeführt wurde. Zwei Jahre später hielt das „Zentralabitur“ in Hessen Einzug, indem die schriftlichen Prüfungsaufgaben nicht mehr durch die Prüfungslehrkraft, sondern durch eigens dafür vom Land Hessen eingerichtete Abiturkommissionen verfasst wurden. Per Erlass wurde zudem bestimmt, in welchen Fächern externe Zweitkorrekturen durchgeführt werden, d. h. als Zweitkorrektur wurde eine Lehrkraft einer anderen Schule bestimmt. Die Kombination von Abiball und Überreichung der Abiturzeugnisse führte zu sehr langen Veranstaltungen, sodass seit 2007 wieder akademische Feier und Abiball getrennt abgehalten werden. In 2020 und 2021 wurden die Abiturprüfungen unter Corona-Bestimmungen abgehalten, zudem wurde ab 2021 das schriftliche Abitur erst nach den Osterferien abgelegt, damit endet seitdem der Unterricht im Abiturjahrgang mit den Osterferien. Die letzten Jahre waren geprägt von der Vereinheitlichung des Abiturs auf Bundesebene und der geplanten Durchführung von bundesweiten zentralen Abiturprüfungen.
Der Abigag wurde Mitte der Nuller-Jahre reglementiert. Nach Absprache mit der Schulleitung wurde das geplante Programm vorgelegt, der Unterricht sollte dann nicht mehr komplett ausfallen, Sachbeschädigungen und Alkoholkonsum wurden deutlich reduziert. Diese Reglementierung führte aber auch dazu, dass die Aibgags oft nur noch halbherzig betrieben wurden. Bei den Abiturtraditionen traten Ende der Nuller-Jahre zwei Neuerungen auf. Aus der Verkleidung am letzten Schultag („Mein erster Schultag“) wurde eine ganze Mottowoche und aus den damals schon in den 90er Jahren aufgehängten „Betttuch“-Plakaten wurden Motivationsplakate, die an die Zäune der Schule angebracht wurden.
Dr. Paul Schlöder
- 1949 Abiturfeier LZ vom 27.09.49
- 1949 die ersten Abiturienten
- 1949 ZeugnisS1-anonym
- 1949 Feierstunde Abitur
- 1949 Zentrale Abituraufgaben
- 1949 ZeugnisS2 anonym
- 1950er Verkündigung der mündlichen Prüfungsergebnisse
- 1955 Abiturienten
- 1955 Anforderungen Sportabitur Jungen
- 1959Abiturklasse
- 1960er Verbrennung der Hefte nach dem Abitur
- 1963 Zug der Abiturklasse durch Langen nach Abiprüfung (Winter)
- 1963 Einladung Abiball und Feier
- 1967 Abiturklasse
- 1978 gebeugte Abiturient Skulptur
- 1983 Schüler als Koch
- 1983 Abifete-Einladung
- 1983 Abiturienten SSG-Platz alt
- 1983 Der Stein des Anstoßes
- 1983 Einladung zur Abschlussfeier – jetzt erst recht
- 1990er Verewigung der Abiturjahrgänge
- 1994 Abigag
- 1994 Abi-Verewigung an der Schule
- 1998 Abigag Beachparty
- 1999 Erbe etlicher Abigags
- 2000 Abiturienten
- 2000 Für was denn Abigag?
- 2000 Abiball Entrittskarte
- 2010 Abigag
- 2010 Abiball
- 2013 Abiball
- 2013 Abiball-Tanz
- 2013 Jahrgangsfoto Abibuch
- 2020 Abiturienten unter Corona-Abstand vor dem schriftlichen Abitur
- 2020 Akademische Feier mit Maske und Abstand
- 2020 Corona-Abitur mit Abiplakaten
- 2021 Akademische Feier mit Maske und Abstand Publikum
- 2024 Gehts wieder los